»Das ist im höchsten Maße global asozial.«
Das große Interview


»Das ist im höchsten Maße global asozial.«
Das große Interview
Hunger, Stürme und unerträgliche Hitze – die Menschheit endet im Kochtopf, wenn wir den Prognosen der Wissenschaft glauben dürfen. Doch wo liegen die eigentlichen Ursachen von Regenwaldvernichtung, Artensterben und Klimawandel? Wir haben mit dem Zoologen und Evolutionsbiologen Josef H. Reichholf über die katastrophalen Folgen unserer Landwirtschaft gesprochen.
Das Interview führte Tim Turiak mit freundlicher Unterstützung der Tonhalle Düsseldorf.
Hunger, Stürme und unerträgliche Hitze – die Menschheit endet im Kochtopf, wenn wir den Prognosen der Wissenschaft glauben dürfen. Doch wo liegen die eigentlichen Ursachen von Regenwaldvernichtung, Artensterben und Klimawandel? Wir haben mit dem Zoologen und Evolutionsbiologen Josef H. Reichholf über die katastrophalen Folgen unserer Landwirtschaft gesprochen.
Das Interview führte Tim Turiak mit freundlicher Unterstützung der Tonhalle Düsseldorf.
Die Natur ist dem Menschen fremd geworden. Woran liegt das?
Wir brauchen heute Ausnahmegenehmigungen vom Naturschutz, um uns in der Natur so betätigen zu können, wie das zum Beispiel in meiner Kindheit und Jugendzeit und auch während meines Studiums noch selbstverständlich war. Tatsächlich betrachten wir die Natur als etwas vom Menschen Getrenntes und bauen eine Schwelle vor, die wir nur mit entsprechend hoher Eigenmotivation überschreiten können. Deshalb haben wir heute ein Naturbild, das sich völlig von dem unterscheidet, das in meiner Zeit selbstverständlich war: Man ist damals mit Tieren und Pflanzen ganz normal umgegangen.
Wie hat sich das zum Beispiel gezeigt?
Man hat etwa am Muttertag keine Schnittblumen im Laden gekauft, sondern ist in die Wiesen gegangen, um einen Strauß zu pflücken. Die Blumen sind deshalb nicht seltener geworden. Heute ist es so, dass wir die Natur, vor allem die heimische, schätzen, aber Ausnahmegenehmigungen brauchen, um uns näher mit ihr befassen zu dürfen. Und das Blumenpflücken ist praktisch verboten, zumindest moralisch wird es inzwischen so gesehen. Was man nicht im Laden gekauft hat, ist irgendwie anrüchig, sprich: so etwas wie ein Raub. Diese totale Abtrennung der Menschen von der Natur ist ein Kernproblem unserer Zeit.
Die Abtrennung von der Natur wird ja als Schmerz schon sehr lange beschrieben. Während der Industrialisierung verdirbt Kohlestaub die Luft und Asthma entwickelt sich zur Volkskrankheit. In der Stadt wächst die Sehnsucht nach dem Grünen, Schönen, Natürlichen. Das ist der Mensch der Romantik.
Es gab damals ein ähnliches Umweltproblem wie heute. Mit dem Kohlestaub in der Luft, mit der katastrophalen Situation in den Industriegebieten ist zwangsläufig eine Sehnsucht nach einer besseren Umwelt entstanden, in der man frei atmen kann. Also vergleichbar mit dem, was heute die Massen erfasst. Gerade etwa, wenn sie in den Urlaub fahren. Dort atmen sie die Luft des Meeres oder sind eben irgendwo in den Bergen in den schönen Landschaften unterwegs. Aber die Landschaft, die Natur im engeren Sinne, ist bloße Kulisse für den Urlauber. Und das war auch zur Zeit der Romantik so: Keiner hatte auch nur den Schimmer einer Ahnung, was er da wirklich sieht.
Goethe.
Selbst Goethe hatte Schwierigkeiten, obwohl er noch der Beste von allen war. Aber indem er etwa nach dem ›Urbild‹ der Pflanze suchte oder die Farben auf völlig andere Weise als die Physiker interpretierte, zeigt, dass er von vornherein ein idealistisches Bild der Natur besaß und sich sein ›direkter‹ Zugang darauf beschränkte, über Stechmücken zu lamentieren, die ihm die Schäferstündchen in der Rheinaue verdarben.
Wie sieht ein besseres Naturverständnis aus?
Ein besseres Naturverständnis nimmt im Idealfall die Tiere und Pflanzen so, wie sie sind und versucht in ihre Lebensweise und Besonderheiten einzudringen. Es vermeidet tunlichst, die eigenen Vorstellungen in die Natur hinein zu projizieren. Das ist der wichtigste Unterschied zwischen der romantischen Naturbetrachtung und dem, was heutige, engagierte, insbesondere aus dem wissenschaftlichen Bereich stammende Naturschützer anstreben. Natürlich wollen sie das eigene Erlebnis auch für sich, für die Kinder oder ganz allgemein für die nachkommenden Generationen erhalten. Aber sie verklären es nicht, sondern sie nehmen auch die Stadtnatur wahr: Der Wanderfalke, der am Kölner Dom oder in München an den Türmen der Heizkraftwerke nistet, ist eben auch ein Wanderfalke und nicht deswegen denaturiert, weil er in der Großstadt lebt. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied.
»Die Städte heute sind nicht unwirtlich, schon gar nicht für Tiere und Pflanzen.«
Breite Bevölkerungsschichten pflegen nach wie vor das Vorurteil: Land ist gut. Stadt ist böse. Was antworten Sie denen?
Genau das ist ein Vorurteil, das ich vielen Naturschützern und insbesondere auch der Partei der Grünen vorwerfe, die bis heute gerne von der ›Unwirtlichkeit der Städte‹ spricht. Dabei ist das ein uralter Slogan von Alexander Mitscherlich, der eigentlich ein soziales Milieu, ein soziales Problem beschreiben wollte. Die Städte heute sind nicht unwirtlich, schon gar nicht für Tiere und Pflanzen. Im Gegenteil: je größer die Stadt, umso artenreicher ist sie.
Was hat die Stadt, was dem Land fehlt?
Mit zunehmender Größe der Stadt wird sie an Strukturen reicher. Strukturen meint alles, was unterschiedliche Lebensmöglichkeiten bietet: Gärten, Hecken, Parkanlagen und Wasserflächen sind gemeint. Aber auch Straßenränder sind Lebensmöglichkeiten für Tiere und Pflanzen. Letztendlich sind es die Gebäude selbst, an denen ja bekanntlich nicht nur so manche Vogelart nistet, sondern auch viele Insekten vorkommen, Marder im Dachgebälk umhertollen oder Fledermäuse sich einnisten. Dem gegenüber steht ein Land, auf dem riesige Flächen gleichzeitig bewirtschaftet werden und das an Strukturen verarmt ist. Daneben bietet die Stadt in der Vielfalt an Lebensräumen fast nirgendwo ein üppiges Angebot an potenziell nutzbarer Nahrung: Es herrschen überall unterschiedliche Verhältnisse, aber insgesamt bleibt das Leben mager, und man muss sich mit dem arrangieren, was zu finden ist. Das verhindert, dass es zu Massenvermehrungen kommt. Deshalb müssen in den Städten praktisch nirgendwo Kontrollmaßnahmen ergriffen werden, weil Tiere zu häufig werden oder Pflanzen zu sehr wuchern. Ein Ausnahmefall ist die Kanalisation, in die alle möglichen Nahrungsreste abgespült werden und die Ratten relativ gut davon leben können. Ganz andere Verhältnisse herrschen auf dem Land: Dort wird permanent und massiv Gift eingesetzt. Ein dritter Faktor ist das Phänomen, dass Städte Wärmeinseln sind. In der gegenwärtigen Diskussion darf man diese Tatsache fast nicht betonen, weil es politisch nicht korrekt ist, aber es ist ein bio- und ökologisches Faktum: Da, wo es wärmer ist, geht es den allermeisten Tieren und Pflanzen besser. Die Verhältnisse auf dem Land sind dagegen durch maßloses Überdüngen verschärft worden. Je üppiger die Vegetation hier wuchert, umso mehr Wasser wird verdunstet und umso kühler und feuchter ist es im bodennahen Bereich. Und der letzte Punkt: In der Stadt werden auch größere und große Tiere selten oder gar nicht verfolgt. Sie können sich mit dem Menschen arrangieren und stellen sich auf die Lebensrhythmen ein. Viele ansonsten nachtaktive Arten werden in der Stadt tagaktiv und können beobachtet werden. Die Stadtbevölkerung findet selbst an solchen Tieren gefallen, die auf dem Land äußerst verpönt sind, wie zum Beispiel die Wildschweine. Wenn in Berlin die Sauen mit ihren Jungen rumziehen, dann ist das eine Attraktion, und die Tiere werden eventuell an einer Frittenbude gefüttert. Da kommt nicht gleich die Bereitschaftspolizei und setzt eine wilde Jagd an, sondern man arrangiert sich. Und zwar gilt das nicht nur für Berlin, sondern global.
Berlin ist die Hauptstadt der Nachtigallen. Und Elche durchwandern skandinavische Wohngebiete: Die Städte sind Archen.
Ganz genau. Und das drückt einen ganz wesentlichen Unterschied im Verhältnis zu den Tieren aus. Die Vorstellungen der Stadtbevölkerung sind sicher ein Produkt des Fernsehens und auch der Tatsache, dass man nicht von den Flächen, die man bewohnt, direkt leben muss. Deshalb ist man, was Tiere als Mitbewohner betrifft, erheblich toleranter als die Landbevölkerung. Wenn dort ein Marder auftaucht, ist das gleich eine Riesengefahr für den Hühnerhof, auch wenn ein solcher eventuell gar nicht mehr vorhanden ist: Der Marder muss in jedem Fall erlegt werden! In der Stadt hüpfen die Marder herum, und wenn sie wieder mal ein Auto beschädigen, dann schimpft man hier interessanterweise nicht unbedingt so sehr auf den Marder, sondern auf die Autofirmen, die es nicht schaffen, bei ihrer überragenden Technik den Motorenraum marderfrei zu halten.
Man hat ein schlechtes Gewissen gegenüber der Natur?
Ja. Vor allen Dingen wenn es ums Töten geht. Die Stadtbewohner wägen ab: Ist das wirklich notwendig? Wie sind die Umstände? Muss das sein? Oder bin ich möglicherweise selber schuld? Draußen, gerade in der bäuerlichen Bevölkerung, denkt niemand im Traum daran. Da heißt es einfach: Das muss weg. Und dann wird der Jäger gerufen, oder es wird Gift eingesetzt. Das Ergebnis ist, dass die allermeisten Tiere, die eine nennenswerte Größe haben, draußen scheu sind. In der Stadt sind sie mit Menschen vertraut, auch wenn sie nicht gefüttert werden. Der Mensch ist hier nicht mehr ein Feind der Tierwelt, was er von Natur aus auch nicht ist. Er ist durch die früher verständlichen Abwehrmaßnahmen der Menschen zum Feind geworden: Es ging ums eigene Überleben. Man konnte eben nicht mit den Kaninchen hausen oder mit den Rehen die Karotten teilen. Aber das ist heute längst nicht mehr der Fall. Und trotzdem verhält sich gerade die bäuerliche Landbevölkerung so, als ob sie am Verhungern wäre. Da darf wirklich kein Prozent an Tieren verlustig gehen oder eventuell der Getreide-Ertrag geschmälert werden, weil ein paar Blumen im Feld blühen.
»Denn die eine Seite ist sozusagen zum Vergnügen da, die andere muss dagegen billiges Fleisch liefern.«
Auf der anderen Seite geht der Städter in den Supermarkt und kauft klinisch sauber abgepacktes Fleisch. Die Massentierhaltung passt nicht in unser Bild vom umweltfreundlich agierenden Europäer, deshalb müssen wir uns sehr anstrengen, es uns zu verheimlichen: Wir unterhalten ein riesiges, unsichtbares Schlachthaus.
Ja. Unser Verhältnis zum Tier ist zutiefst gespalten. Auf der einen Seite legen wir insbesondere bei Haustieren menschliche Maßstäbe an, auf der anderen Seite blenden wir die unmenschliche Behandlung in der Massentierhaltung komplett aus. Denn die eine Seite ist sozusagen zum Vergnügen da, die andere muss dagegen billiges Fleisch liefern. Dafür lassen wir züchten, quälen und töten. Die wenigen Landwirte, die sagen: „Leute kommt, Ihr könnt in unsere Ställe reinschauen, da erschrecken die Kühe und Schweine nicht.“ – das sind auch die wenigen, die ordentlich produzieren.
Wir Konsumenten kaufen uns von der Verantwortung frei, indem wir nett zu den Mardern sind, für mehr Fahrradwege protestieren und hier und da Biogemüse in den Warenkorb packen. Wir betreiben eine Art Ablasshandel: Die Seele rechnet.
Nicht nur die Seele. Es gibt den mittelalterlichem Ablasshandel auf allen Ebenen: Er beginnt im privaten Bereich und reicht bis hin zum Kyoto-Protokoll, wo eben auch Verschmutzungsrechte gehandelt werden, anstatt die Verschmutzung von vornherein so zu verdammen, dass es nur die eine Tendenz geben kann: nämlich die, immer weniger zu verschmutzen. Das wäre der ehrliche, auch in dem Sinne vernünftige Weg, der für alle nachvollziehbar wäre. Aber das diejenigen, die es sich finanziell leisten können, kaufen sich davon frei. Das ist im höchsten Maße global asozial.
Apropos global. Welche globalen Konsequenzen hat unsere Massentierhaltung?
Eine der bedeutendsten globalen Konsequenzen ist die Tatsache, dass unsere Massen-Rinderhaltung in den Ställen ganz erheblich zur Belastung der Erdatmosphäre beiträgt. Wenn wir sie bilanzieren, mindestens so viel, wenn nicht mehr als der gesamte Kraftfahrzeugverkehr. Bei dem versucht man allerdings, an den Schrauben der ausgestoßenen Schadstoffmengen zu drehen. Während die Landwirtschaft weiter gefördert wird. Wenn Schweineställe mit zehntausenden Tieren und Hühnermastanlagen in unvorstellbaren Größen weiterhin nicht nur nicht gebremst, sondern sogar neu genehmigt werden, dann sieht man, dass das System offensichtlich nicht in der Lage ist, sich selbst zu korrigieren. Nehmen wir das Beispiel Vogelgrippe: Wenn die Mastanlagen von außen bedroht werden, dann wird interessanterweise die Natur dafür verantwortlich gemacht. Dann sind es die bösen Zugvögel, die die Massengeflügelhaltung bedrohen, anstatt zuzugeben, dass Epidemien die zwangsläufige Folge solcher Massenhaltung sind. Da ist man sowohl als Umweltschützer, als auch als Biologe völlig ratlos, weil man natürlich an der eigenen beruflichen Bedeutung grundlegende Zweifel entwickeln muss. Wofür macht man das eigentlich alles, wenn es total bedeutungslos ist?
»Der wichtigste Grund ist, dass Masse über die Subventionen bezahlt wird und nicht Klasse und Qualität.«
Wir produzieren bekanntermaßen Masse statt Klasse. Wie kommt es eigentlich dazu?
Der wichtigste Grund ist, dass Masse über die Subventionen bezahlt wird und nicht Klasse und Qualität. Hätte man von vornherein die politischen Rahmenbedingungen so gestaltet, dass qualitativ hochwertige Produktionen gefördert worden wären und billige Massenware entsprechend besteuert worden wäre, dann würden die Verhältnisse ganz anders aussehen. Die gegenwärtige Lage ist leider total verquer in dieser Hinsicht. Dabei werden die Biobetriebe auch noch dafür bestraft, dass sie besser wirtschaften wollen: Sobald ihnen Giftstoffe von den Nachbarn, die konventionell wirtschaften, auf ihre Flächen eingetragen werden, können sie ihre Produkte praktisch wegwerfen.
Aber schielt das Gros der Konsumenten nicht eh nach dem günstigsten Preis?
Natürlich stimmt die Klage, dass im Supermarkt oft das Billigste gekauft wird. Aber auch das ist eine Folge des Subventions-Systems. Den Käufern bleibt es verborgen, wie viel Geld sie wirklich für die Billigwaren bezahlen: über ihre Steuern, die dann in die Subventionen fließen. Müsste man alles ›direkt‹ bezahlen, würde sich sehr schnell zeigen, dass die Massenproduktion in Wirklichkeit so teuer ist, dass sie sich Grunde gar nicht lohnt. Noch mehr, wenn sie die Folgeschäden, die sie verursacht, auch begleichen müsste: etwa die Belastung des Grundwassers, das Verdriften von Giften in andere Bereiche hinein. Von den Schäden ist die konventionelle Landwirtschaft freigestellt. Wir wissen, dass es anders ginge: Man muss nur nach Österreich schauen. Das Bundesland Salzburg produziert zu 50 Prozent Bio, und viele andere Regionen des Landes können auf ähnlich hohe Prozentsätze verweisen. Dabei ist Österreich bekanntermaßen auch Mitglied der Europäischen Union. Es müsste also nicht so sein wie es bei uns ist. Unser System hat die Bauern wegselektiert und nur wenige große Unternehmer begünstigt. Und die kämpfen mit ihren teuren Maschinen und einem riesigen Aufwand in der internationalen Konkurrenz ums Überleben. Im Endeffekt kommen die Milliarden und Abermilliarden an Subventionen, die wir zahlen, gar nicht unserer Landwirtschaft zugute, sondern den internationalen Großkonzernen.
Woher kommt eigentlich das Futter für die vielen Rinder?
Die gewaltige Ausweitung des Maisanbaus ist eine Hauptquelle für das Tierfutter. Die oft von der Landwirtschaft vorgebrachte Argumentation: Wir müssen ja so produzieren, weil wir so viel verbrauchen, stimmt wirklich nicht. Es wird gerade in diesem Bereich Fleisch in Massen produziert, das in den Export geht. Und ich bin nicht der Meinung, dass es Aufgabe der deutschen Landwirtschaft ist, den viel ärmeren Nationen, die von Natur aus bessere Weidegründe hätten, auf dem Weltmarkt Konkurrenz zu machen, und das mit hochsubventionierten Anlagen, die im Hintergrund von den Steuerzahlern bezahlt worden sind. Außerdem müssen riesige Flächen an Tropenwäldern gerodet werden, um die uns fehlenden Futtermittel anzubauen. Soja in Südamerika, Ölpalmen in Südostasien. Es werden also gewaltige Zerstörungen in fernen Regionen getätigt, ein Verhalten, das – und das muss man in aller Deutlichkeit sagen – das neokolonialistisch ist. Da beuten eine reiche Nation wie Deutschland und die ganze EU die Länder der Dritten Welt bzw. die Schwellenländer aus, um ihre völlig unnötig auf extrem hohem Niveau gehaltene Landwirtschaft zu versorgen. Und dass sich das die Dritte Welt weiterhin bieten lässt, ist nichts anderes als wirtschaftspolitische Erpressung.
»Diese Massentierhaltung ist global schlicht und ergreifend destruktiv.«
Wie viel Regenwald geht uns denn tatsächlich verloren?
In meiner bisherigen Lebenszeit ist der Tropenwald um fast die Hälfte geschrumpft. Und davon ist der größere Teil in die Produktion von Futtermitteln oder direkt von Rindfleisch hinein geflossen. Nicht um Lebensraum oder Lebensmöglichkeiten für die arme Bevölkerung zu schaffen, sondern um auch dort Export-Artikel für die Großkonzerne zu erzeugen. Das heißt also mit anderen Worten: Alles, was an zusätzlichen Futtermitteln in Deutschland aus Tropen- und Subtropen-Regionen importiert werden muss, bedeutet, dass unser Stallvieh Tropenwälder auffrisst. Das hat den Effekt, dass nicht nur der Methan-Ausstoß der Rinder in die Atmosphäre geht, sondern durch die Vernichtung der Wälder auch gewaltige Kohlenstoffdioxid-Mengen freigesetzt werden. Auf diese Weise wird die Erdatmosphäre in doppelter Weise belastet. Und das geht immer so weiter. Denn der Bedarf ist nach wie vor da. Solange unsere Viehbestände auf dieser exorbitanten Höhe gehalten werden, ist das unvermeidlich. Wir müssen in Deutschland ja nicht wirklich eineinhalb Millionen Kühe haben oder 26 Millionen Schweine, von denen die wenigsten ein ganzes Jahr erleben. Diese Massentierhaltung ist global schlicht und ergreifend destruktiv. Das ist seit langem bekannt, das ist überhaupt nichts Neues, aber es wird politisch absolut nichts dagegen unternommen.
29,4 Millionen Hektar Wald, eine Fläche fast so groß wie Großbritannien und Irland zusammen, wurden im Jahr 2017 abgeholzt, berichtet Global Forest Watch (GFW). Gut die Hälfte davon betrifft die Wälder am Äquator. Die Spitzenreiter sind Brasilien mit 4,52 Millionen Hektar, die Demokratische Republik Kongo mit 1,47 Millionen Hektar und Indonesien mit 1,3 Millionen Hektar. Die drei Länder sind wichtige Rohstofflieferanten Deutschlands und der EU. Hauptverursacher der Waldvernichtung sind die Landwirtschaft, die Holzindustrie, der Bergbau, große Infrastrukturprojekte wie Wasserkraftwerke und Landstraßen in den Regenwaldgebieten sowie Waldbrände. So werden auch für unseren Konsum von Soja, Palmöl, Biosprit, Holz, Zellulose sowie Bodenschätze wie Eisen, Aluminium, Gold und Coltan die Wälder der Erde vernichtet.
Wir betreiben im Umweltschutz bloße Symbolpolitik?
Richtig. Man vergießt buchstäblich Krokodilstränen und tut so, als ob uns speziell in Deutschland so viel daran gelegen wäre, das Weltklima zu retten. Diese Welt-Klimaretter in der deutschen Politik praktizieren im Klartext ein ›Weiter so‹ wie bisher. Denn es ist ganz klar, dass es auf dem Weg, der beschritten wurde, nicht geht. Da werden die Klimaziele nie erreicht. Wir müssen in genau jenen Bereichen, wo wir global wirken, weit stärker zurückfahren, als in den lokalen und regionalen Bereichen. Dann ist es im Grunde genommen egal, wieviel CO2 ein Pkw in unserem Land pro Kilometer ausstößt, wenn wir dafür die Massen an Stallvieh reduzieren würden und dadurch Gewinne in den Tropen zu verbuchen hätten. So wäre ein riesiger Spielraum gegeben, der global-klimatisch auch etwas bewirkt.
Verzeihung, Spielräume für den Straßenverkehr?
Die Entwicklung in der Vergangenheit verlief nach dem Muster: Je besser die Abgasreinigung und die Motorleistung bei den Pkws geworden war, umso größer wurden die Fahrzeuge. Heute fahren so viele SUVs herum, dass ein Kleinwagen schon etwas Komisches geworden ist. Das heißt über die Masse und den damit verbundenen Spritverbrauch, der für sich genommen gering aussieht, ist all das wieder kompensiert worden, was an wirklichen Einsparungen in den Motorleistungen, im Schadstoffausstoß eigentlich hätte erzielt werden können. Aber wir sind nicht bereit, mit Autos vom Typ des alten VW-Käfers rumzufahren, sondern wir wollen eine kleine Burg um uns herum haben. Und das ist auch verständlich, denn wenn man in einen Verkehrsunfall verwickelt ist, will man nicht unter den Toten oder schwer Geschädigten sein. Zwar ist die Zahl der Toten massiv zurückgegangen, aber das liegt primär an der verbesserten Sicherheit der Autos und nicht am besseren Fahrverhalten.
Wenn die Konsequenzen der Massentierhaltung so schlimm sind, warum ist sie dann überhaupt noch politisch erwünscht?
Ich bezweifle, dass es tatsächlich erwünscht ist. Ich fürchte, es handelt sich um ein System, das zum Selbstläufer geworden ist. Und es findet sich in keiner Partei, die politisch Bedeutung hat, die Bereitschaft, daran wirklich etwas zu verändern. Weil sie befürchten muss, dass es ihr politischer Selbstmord würde. Es ist eine Tatsache, dass Vierjahres-Perioden eben nicht geeignet sind, Änderungen an den Entwicklungen vorzunehmen, die über Jahrzehnte bereits gelaufen sind und über weitere Jahrzehnte weiterlaufen werden. In der Konsequenz bedeutet das, dass das System erst selbst zusammenbrechen muss. Dann zahlen wir natürlich alle die Zeche dafür. Nebenbei bemerkt gibt es das gleiche Problem auch bei anderen großen Umweltschutz-Themen: etwa beim Klimaschutz. Wirksame Maßnahmen werden im Endeffekt immer nur vertagt. Mit Minischritten, die oftmals gar nicht in die richtige Richtung gehen, tut man so, als ob man etwas tun würde.
»Aber die Tatsache, dass die Menschheit weiter wächst, die können wir nicht aus der Welt schaffen.«
Mal Hand aufs Herz: Gibt es den Klimawandel wirklich?
Sicher gibt es einen Klimawandel. Den hat es immer gegeben, und dass inzwischen siebeneinhalb Milliarden Menschen die Lebensbedingungen auf der Erde massiv und nachhaltig verändern, ist selbstverständlich. Manches, was dem Klimawandel zugeschoben wird, ist allerdings höchst fraglich und wird ganz offensichtlich aus zwei Quellen gespeist. Die eine Quelle ist die Absicht, ein schlechtes Gewissen zu erzeugen. Dafür bietet der Klimawandel die perfekte Möglichkeit. Der andere Grund ist, zu verbergen, dass man eigentlich nicht weiß, warum sich jetzt etwas geändert hat. In diesem Fall ist der Klimawandel die perfekte Erklärung. Richtig ist natürlich, dass sich die gesamte Weltbevölkerung darauf einstellen muss, dass sich die Lebensbedingungen auf der Erde in den kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten ändern werden. Dabei gibt jedoch die Vorstellung, dass der heutige Zustand der noch tragbare oder dass der vor 100 Jahren der Beste sei, einfach eine falsche Basis ab. Vor gut hundert Jahren ging es der überwiegenden Mehrheit der Europäer miserabel. Deswegen sind Millionen und Abermillionen ausgewandert. Das 19. Jahrhundert war weit schlechter als Lebenszeit für die Menschen als unsere Gegenwart. Und wir werden auch in absehbarer Zeit weiterhin mit allen Kräften versuchen, gut zu leben. Und immer mehr Menschen werden gut leben wollen. Also geht kein Weg daran vorbei, dass sich die Verhältnisse global ändern. Die einzige vernünftige Reaktion kann sein, wo immer es geht, rechtzeitig Anpassungen vorzunehmen. Aber die Tatsache, dass die Menschheit weiter wächst, die können wir nicht aus der Welt schaffen. Und dass ein immer größerer Anteil dieser dann lebenden Menschheit größten Wert darauf legt, auch so zu leben wie die Europäer und Nordamerikaner oder die Ostasiaten, ist auch selbstverständlich. Die Zukunft wird also massive Veränderungen bringen.
Die Sahara war einst grün. Machen wir uns nicht zu Recht Sorgen, dass wir unseren Planeten im wahrsten Sinne des Wortes verwüsten?
Sicher ist die Sorge berechtigt. Wir tun das. Und so manche heutige Wüste ist Menschenwerk. Auch Regionen, wie weite Teile der Landschaften ums Mittelmeer, sind eigentlich verwüstet. Wir schätzen sie jetzt als Ferien- und Erholungsraum. Landwirtschaftlich sind sie nicht mehr ertragreich genug. Das sind veränderte Rahmenbedingungen. Änderungen laufen seit Jahrtausenden. So zu tun, als ob dies nur in unserer Zeit der Fall wäre und das alles dem Klimawandel zuzuschreiben, ist wirklich nicht nur naiv, sondern ist eine völlige Missachtung der Geschichte. Aber wer stellt sich schon der Geschichte? Das tun ja auch die Historiker nur äußerst ungern, weil sie, sobald sie Geschichte betrachten, gezwungen sind, Positionen einzunehmen. Und mit diesen Positionen werden Wertungen verbunden. Wenn ich sage, das 19. Jahrhundert war für Tiere und Pflanzen viel besser als unsere Zeit, dann ist das objektiv richtig. Aber es ist natürlich ganz falsch, wenn ich die Menschen miteinbeziehe. Denen ging es vielerorts und in großen Teilen der Gesamtbevölkerung miserabel. Geschichtliche Positionen sind hinterfragbar und nicht einfach so wie in der strengen Naturwissenschaft nach dem Motto darstellbar: Das ist der Ablauf, so war‘s eben.
Aber die Veränderungen werden sich nicht nur auf bloße Verwüstungen beschränken. Wir werden in den Trockenengürteln mit Wasserkriegen rechnen dürfen. Die vom Klimawandel betroffenen Menschen werden uns früher oder später auf die Pelle rücken. Und schon jetzt haben wir in Europa die Schotten dicht gemacht. Müssten wir nicht eigentlich Verantwortung übernehmen?
Natürlich, aber das hätte seit je und eh der Fall sein müssen. Es wird nicht klappen. Es wird an der Natur des Menschen scheitern. Denn die Grundhaltung, die die allermeisten Menschen einnehmen, ist doch, das eigene Leben so gut wie möglich zu gestalten. Und nur wenn ein Überschuss an Möglichkeiten vorhanden ist, dann soll auch für die anderen etwas davon abfallen – oder auch nicht, wenn man die Anderen nicht so recht mag. Das war immer so. Und zu hoffen, dass in unserer Zeit oder in der allernächsten Zukunft eine grundlegende Änderung in der Menschheit stattfindet, ist reichlich naiv. Nur äußere Zwänge werden erreichen, dass da und dort und schließlich global Änderungen eintreten. Einsicht, auch wenn sie vorhanden ist, wird uns nicht dazu führen. Da ist das alte Prinzip wirksam: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, und die Menschheit besteht primär aus Fleisch.
Wenn der Meeresspiegel steigt und Venedig unter Wasser steht, dann …
… werden die Venezianer auswandern, wie das die Bewohner vieler Küstenstädte getan haben. Auch New Orleans wird entsprechend reagieren müssen.
Der Klimawandel macht Überflutungen wahrscheinlicher. Laut einer im Fachblatt Science Advances veröffentlichen Studie ist der Anpassungsbedarf in den USA, in Teilen Indiens und Afrikas, in Indonesien und in Mitteleuropa und in Mitteleuropa am größten. In Deutschland könnten künftig sieben Mal so viele Menschen durch Hochwasser gefährdet sein als bisher. Weltweit müssten Deiche ausgebaut, Baustandards verändert, das Flussmanagement verbessert und sogar Siedlungen verlagert werden, fordern die Wissenschaftler. Die Ergebnisse »sollten eine Warnung für die Entscheidungsträger sein. Wir müssen jetzt beides tun: Anpassung an den bereits verursachten Klimawandel und Begrenzung zukünftiger Erwärmung. Nichtstun wäre gefährlich.«
Was müssten wir jetzt tun, um die Lage doch noch in den Griff zu kriegen?
Das Wichtigste wäre, dass wir im eigenen Land so gut wie möglich vorsorgen. Gerade im Hinblick auf den Klimawandel. Dass würde möglicherweise auch andere Länder überzeugen. Wenn wir aber wie bisher als Lehrmeister für die Welt auftreten, dann wirkt das nicht.
Es gibt ein Buch von Ovid: ›Die Metamorphosen‹. Die handeln davon, dass der Mensch sich unter Schmerzen verwandelt. Muss also die Katastrophe erst eingetreten sein, damit wir Lehren aus ihr ziehen?
Ich fürchte, ja. Auch wir haben eine entsprechende Lehre als Bevölkerung hinter uns: den Zweiten Weltkrieg. Der wäre spätestens nach anderthalb Jahren beendbar gewesen, weil absehbar war: Das kann so nicht weiter gehen, es sei denn, es führt in die Katastrophe. Und trotzdem ist bis zur Katastrophe weiter gemacht worden. Letztlich gilt das für jeden Krieg. Im Prinzip heißt das, dass man selbst da, wo alles ganz offensichtlich böse endet, weitermacht. Wie soll dann in weicheren Bereichen die bessere Einsicht die Oberhand gewinnen?
Katastrophen sind auch Unterbrechungen: Sie schaffen neue Ausgangssituationen.
Genau das ist eigentlich das Positive an Katastrophen für diejenigen, die nicht getroffen wurden. Die schöpfen dann das Positive ab. Für die Betroffenen ist es natürlich buchstäblich ›die Katastrophe‹.
Dann bleibt uns bloß, auf die Katastrophe zu hoffen.
Auf dass sie gelinde ausfallen möge.
Helfen Sie Ihren Freunden dabei, nicht komplett zu verblöden. Teilen Sie dieses Interview:
Prof. Dr. Josef H. ReichholfWer Reichholf gegenübersteht, trifft auf einen drahtigen Kerl, der Schnäuzer trägt und ansonsten sehr viel beige. Im Grunde fehlt nur der Tropenhelm und man würde meinen, ein Exemplar jener abenteuerliustigen Spezies von Mann vor sich zu haben, die sich im 19. Jahrhundert nach Afrika aufmachte, um im Kongo den letzten Stein nach verlorenen gegangenen Zivilisationen oder urzeitlichen Tieren umzudrehen. In Wirklichkeit unternahm der Wissenschaftler seine ersten Expeditionen bereits als Kind, streifte durch die Auen am Unteren Inn und schrieb seine Beobachtungen über Wasservögel in ein Heft. Nach seinem Studium der Biologie, Chemie, Geografie und Tropenmedizin schlug es ihn immer wieder nach Brasilien, um in den Tropen die Artenvielfalt zu erkunden. Später machte Reichholf Karriere im Wissenschaftsbetrieb und Umweltschutz. So war er von 1974 bis 2010 Sektionsleiter Ornithologie der Zoologischen Staatssammlung München und Präsidiumsmitglied des WWF Deutschland. 2005 wurde er mit der Treviranus-Medaille des Verbands deutscher Biologen ausgezeichnet, 2007 erhielt er für seine allgemeinverständlichen Beiträge zur Ökologie den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Bis heute ist Reichholf Honorarprofessor der Technischen Universität München.
Das legen wir Ihnen auch ans Herz.
Newsletter
Der Brief zum Glück


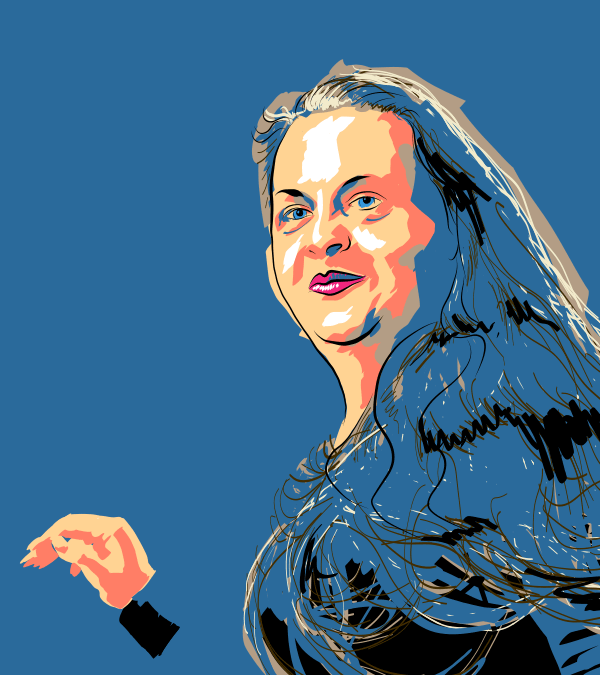
Massentierhaltung:
Es gibt Aufzeichnungen über 3 Jahrzehnte eines Landwirts über die Haltung von Rindern und Milchkühen. Sein Vater hat diese Notizen begonnen, schon zu DDR Zeiten. Sie belegen: Nein, es gibt ( in dieser Region) nicht mehr Tiere.. sie werden nur inzwischen bei einem Bauern gehalten und nicht bei 20-30 Grossfamilien.
Dies kann ich auch aus dem Westen bestätigen.. in dem Dorf in dem ich aufwuchs, hatte jeder zweite ein oder zwei Rinder, die Milchkannen für den Milch- LKW standen vor vielen Türen.
Ich bin der festen Überzeugung dass es ganz ganz sicher NICHT mehr Tiere, in diesem Fall Kühe gibt! Im Gegenteil!
Und.. nicht zu vergessen: Was ganz massiv zugenommen hat ist die Anzahl der Biogasanlagen, die den Mais VERBRENNEN!
Schade dass Sie darüber nichts schreiben.. hier hat ein Bauer rund 200ha nur zum verheizen…. und da ist keine Kuh beteiligt.
mein ganz persönliches Fazit: Nicht umfassend recherchiert und daher schon etwas reisserisch. (Peta?)